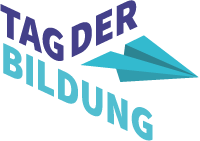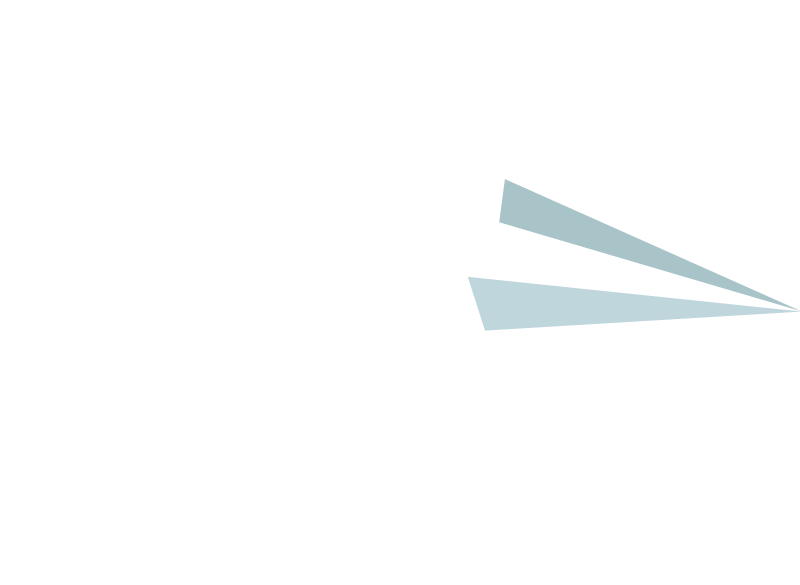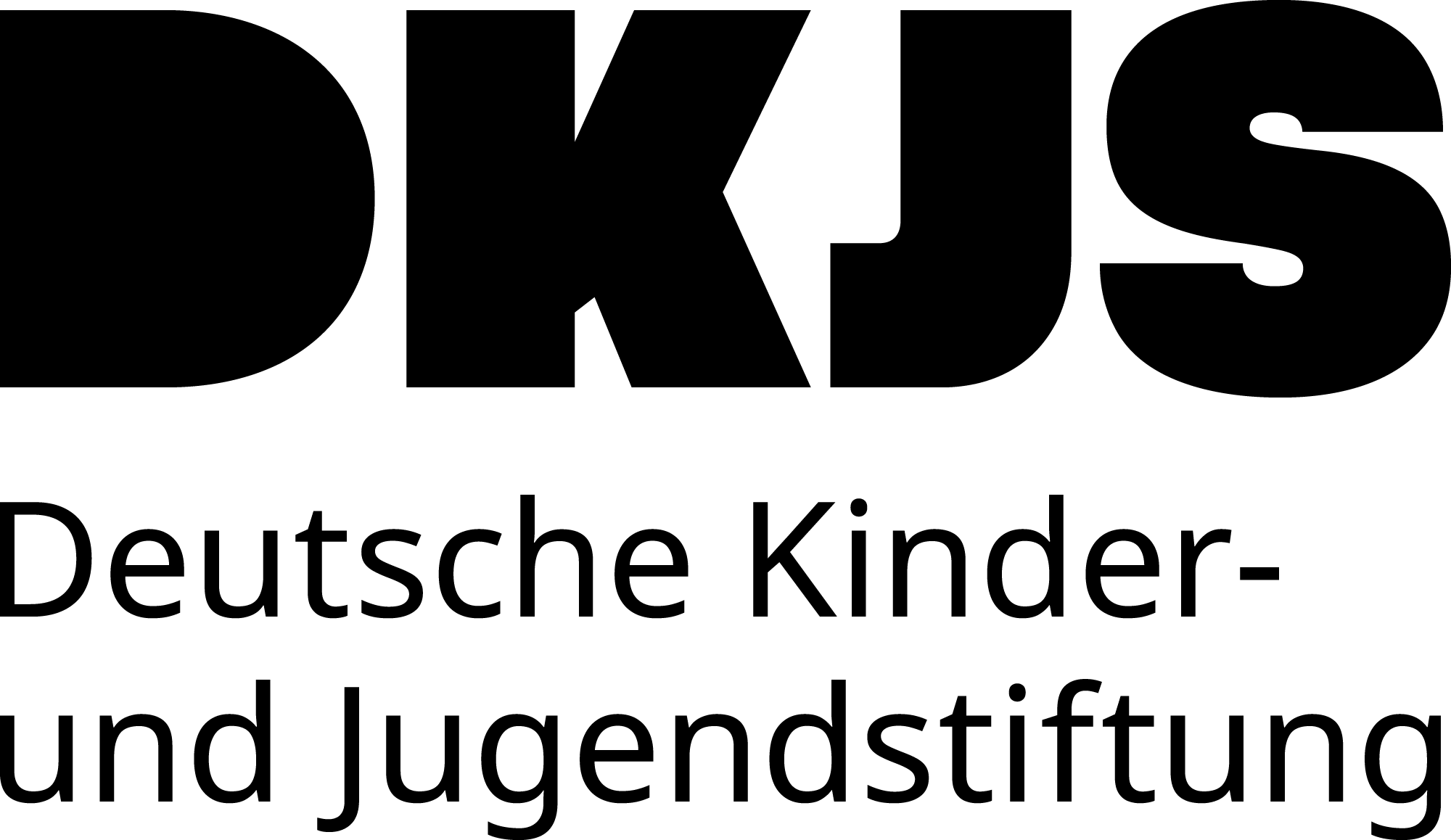Jugendliche fordern kostenfreie Bildung, Safe Spaces und digitale Lernangebote
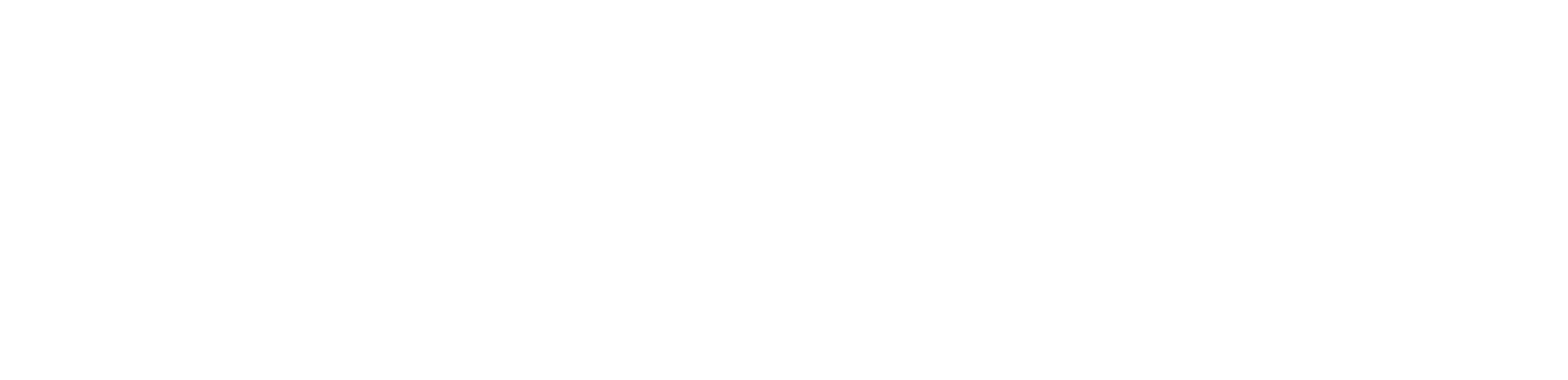
Es ist soweit: Deutschland feiert den Tag der Bildung. Am Vorabend wurden bereits zahlreiche Gebäude im gesamten Bundesgebiet erleuchtet, heute präsentieren Charlotte Kaiser, Stacey Bode und Leon Becht drei konkrete Forderungen vonseiten der Jugend sowie Lösungsvorschläge, die sie zusammen mit weiteren Jugendlichen erarbeitet haben. Gemeinsam mit Gästen wie Karin Prien, Vizepräsidentin der Kultusministerkonferenz, und Journalist Günther Jauch diskutieren die drei Jugendlichen die Forderungen und dahinterliegenden Probleme.
Insgesamt drei Forderungen sind den Jugendlichen besonders wichtig: Sie plädieren für eine kostenfreie Bildung, eine stärkere Unterstützung von „abgehängten“ Schülerinnen und Schülern und dafür, dass die Potenziale der digitalen Lernangebote besser genutzt werden.
Charlotte, Leon und Stacey nehmen Stellung zu den Forderungen
Umfassende kostenfreie Bildung ist die erste der Forderungen, welche die Jugendlichen an die Politik stellt. Gemeinsam mit einer Erweiterung von Investitionen in Bildungsprojekte erhoffen sie sich davon mehr Bildungsgerechtigkeit.
An zweiter Stelle fordern sie eine stärkere Unterstützung von „abgehängten“ Schülerinnen und Schülern, sowohl in pädagogischer als auch psychologischer Sicht. Schule soll so zu einem „Safe Space“ werden. Das heißt, die Schule soll ein Rückzugsort für die sein, die von jeglichen Formen der Ausgrenzung betroffen sind.
Schließlich fordern sie, dass die Potenziale der digitalen Lernangebote besser genutzt werden und der Distanzunterricht weiterhin ermöglicht wird – auch über die Pandemie hinaus.